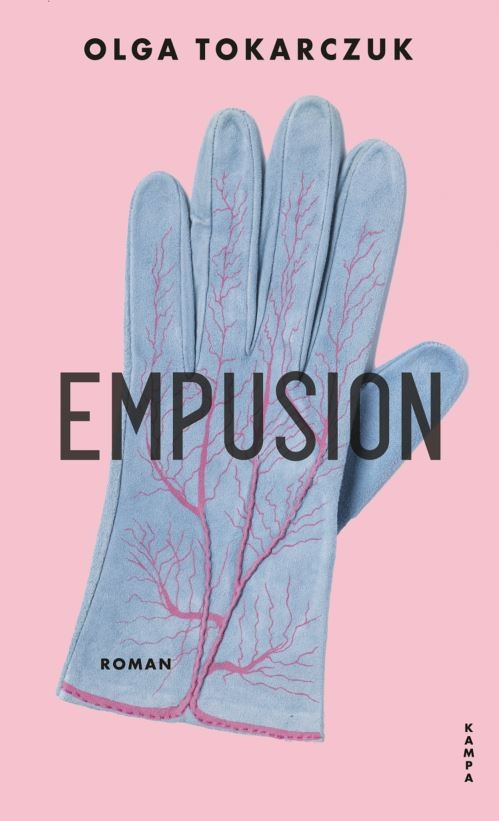
Als feministische-ökologische Replik auf Thomas Manns berühmten «Zauberberg» wird der Roman «Empusion» von Olga Tokarczuk im Klappentext sowie von diversen Literaturkritiker:innen beschrieben. Die polnische Autorin und studierte Psychologin ist mit ihren gesellschaftskritischen Texten zu einer bedeutenden Stimme der Gegenwartsliteratur geworden und erhielt für ihr literarisches Werk den Nobelpreis für Literatur im Jahr 2019. Die titelgebenden «Empusen», weibliche bluttrinkende Geisterwesen aus der griechischen Mythologie, werden zum erzählenden Stimmenkollektiv dieses Romans und agieren als feministische Antithese zu den inhärent misogynen Einstellungen und geisteswissenschaftlichen abendlichen Diskussionsrunden der männlichen Charaktere des Buches. Ihre Stimmen dringen als Chor zu den Lesenden aus den Ritzen des Gasthauses, von den Bodendielen des Zimmers der verstorbenen Wirtsgattin, von den Steinen am Flussbett, aus dem feuchten Erdreich des Fuchsbaus, nichts bleibt ihren Blicken verborgen, konstant klingt ihr Flüstern in den Ohren.
Wir beginnen unsere Reise gemeinsam mit unserem Protagonisten Mieczysław Wojnicz, einem 24-jährigen Ingenieurstudenten aus Lwiw, welcher an Schwindsucht leidet und sich, in Hoffnung auf Heilung, zum Lungenkurort Görbersdorf in Schlesien begibt. Die Erzählung spielt zum Grossteil in eben jener Lungenheilanstalt, verborgen in einem dichten Waldgebiet, an der Grenze zwischen Polen, Tschechien und Deutschland 1913 weniger als ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Gemeinsam warten wir also am Provinzbahnhof mit Mieczysław auf die Kutsche, welche ihn zum besagten Kurort bringen soll. Der wortkarge, merkwürdig anmutende Kutscher bringt Mieczysław durch einen dichten Wald nach Görbersdorf in ein «Gasthaus für Herren». Der Wald ist dicht, dunkel und undurchdringlich, eine Grenze zur Aussenwelt. Man spürt sein Alter, seine Ursprünglichkeit, überall umgibt einem der intensive Geruch feuchter Erde, schwarzer Bäche, dicken Mooses, hoher Wipfel, morschen Holzes und moderner Blätter. Ein stilles Unbehagen macht sich in unserem Protagonisten breit, und man fragt sich, ob er bereits fühlt, dass ein ganz eigenes Leben, ein kollektives Bewusstsein, die Natur um ihn durchdringt. Denn niemand hier ist je unbeobachtet.
Kaum im Gästehaus angekommen, kommt es zum mysteriösen Selbstmord der Gattin des Wirtes Opitz. Der plötzliche Tod der Frau vermag die männlichen Gäste des Wirtshauses, alle Teil des Bildungsbürgertums, jedoch kaum zu berühren. Diese stören sich lediglich am nun verkochten Tafelspitz, welcher der Kochgehilfe aus der Not zubereiten musste, und beginnen über die geistige Schwäche des weiblichen Geschlechts zu philosophieren. Dies wird bald zu einer allabendlichen Gewohnheit. Gemeinsam sinnieren die sterbenskranken Gelehrten bei einem oder mehreren Gläsern des lokalen Likörs, der «Schwärmerei», über die Natur des Lebens sowie der Geschlechtlichkeit und verstricken sich dabei nicht selten in misogyne Thesen. Zwischen Kurgängen, psychoanalytischen Arztbesuchen, den abendlichen (un)geistreichen Diskussionsrunden, der seltsam berauschenden Wirkung der «Schwärmerei», der unerklärlichen Anziehung, welche Mieczysław zum Zimmer der verstorbenen Wirtsgattin verspürt, verbirgt dieser im Stillen ein ganz eigenes Geheimnis. Und was hat es mit dem sich jährlich wiederholenden Verschwinden einiger Kurgäste auf sich, welche womöglich nicht allein ihren körperlichen Gebrechen zum Opfer gefallen sind?
Ein Thema, welches sich mit Nachdruck durch den Roman zieht, sind Grenzen, Kategorien sowie deren Auflösung, Grenzerfahrungen und die Ängste vor dem Undefinierbaren.
Bereits das Setting der Geschichte befindet sich an Punkten des Übergangs, ein Kurort für Sterbenskranke, ein Ort zwischen Heilung und Tod. Schlesien als Grenzgebiet zwischen Nationen, 1913, ein letzter Moment des fragilen Friedens, ein Ausatmen vor dem Ersten Weltkrieg. Nicht zuletzt der dichte Wald, welcher Görbersdorf von der Aussenwelt abschirmt und dem Übernatürlichen einen Platz verschafft. Er ist lebendig, hungrig, verschlingend und voller Wut. Auch beherbergt er eine Vielzahl von Pilzen, ebenfalls Zwischenwesen, weder Tier noch Pflanze, und oftmals ein Symbol für den Tod oder die Vergänglichkeit, für den Übergang in einen anderen Zustand. Hierbei tritt insbesondere eine bewusstseinserweiternde Sorte in den Fokus, welche für die Herstellung des lokalen Likörs verwendet wird.
Die abendlichen Diskussionsrunden der gelehrten Kurgäste prägen im Wesentlichen die Narrative, immer ein Glas der «Schwärmerei» zur Hand. Die Gäste scheinen in ihren Gesprächen wie besessen von binärer Geschlechtlichkeit, todkrank sinnieren sie vermeintlich tiefgründig über die Natur des Lebens und der Menschen. Sie bleiben dabei aber stets verhaftet in einer Hierarchisierung menschlicher Kategorien, wobei ihre Ausschweifungen, unabhängig vom ursprünglichen Diskussionsthema, allzu oft in der Abwertung des Weiblichen enden. Sie schaffen es, trotz ihrer Bildung, trotz ihres wahrscheinlich baldigen Todes, nicht, über die Grenzen der ihnen bekannten Konventionen herauszugehen. Dies würde zu viel Unbehagen auslösen. Dieses Unbehagen scheint sich auch in heutigen gesellschaftspolitischen Debatten widerzuspiegeln und lässt an den internationalen politischen Rechtsruck oder das Aufkommen gesellschaftlicher Phänomene wie der «Manosphere» denken. Auch hier wird klar, dass diskriminierende Strukturen zumeist systemischer Natur sind und diverse Gesellschaftsschichten sowie Milieus zu durchdringen vermögen. All die im Roman verwendeten misogynen Aussagen stammen hierbei aus tatsächlichen Schriften bekannter Philosophen und sind in Referenzen am Ende des Buches nachzulesen. Ihre klingenden Namen reichen dabei von Thomas von Aquin, über Friedrich Nietzsche bis hin zu Jean-Paul Sartre.
Im Allgemeinen sind weibliche Personen auffallend abwesend oder distanziert, unerreichbar in der Narrative, bewegen sich am Rande der Wahrnehmung, treten lediglich fragmentarisch in Erscheinung, als Idee eines Mannes, durch das Rascheln ihrer Röcke, verborgen hinter eleganten Hüten. Auf diese Weise schafft es die Autorin geschickt, den gesellschaftskritischen Kommentar ihres Romans zu unterstreichen. Frauen kommen in den mentalen Repräsentationen der männlichen Charaktere kaum und wenn dann bloss verzerrt vor. Es wird beinahe konstant über sie gesprochen jedoch nie wirklich mit ihnen. Die einzige Frau mit der Mieczysław enger in Beziehung treten kann, ist sein Kindermädchen Gliceria. Diese wird jedoch vom Vater des Protagonisten alsbald entlassen, da er um die «Verweiblichung» seines Sohnes fürchtet. Mieczysław soll eine wahre mannhafte Erziehung geniessen, um seinen in den Augen des Vaters viel zu weichen Seiten entgegenzuwirken, um nicht «weibisch» zu sein. So zwingt der Vater Mieczysław beispielsweise wiederholt eine traditionelle Suppe aus Entenblut zu essen, welcher dieser verabscheut, da der Vater das Gericht für eine äusserst patriotische Speise hält. Ebenso holt er zur Erziehung dessen Onkel hinzu, ein Offizier, welcher ihm militärische Disziplin sowie wahre Männlichkeit beibringen solle. Mieczysław wird von seinem Vater dazu angehalten, zu anderen Kindern Distanz zu wahren, damit sie sein vermeintliches «Anderssein» nicht bemerken.
Im Allgemeinen zeigt sich eine tief verwurzelte Angst vor dem Ambivalenten, dem Andersartigen, dem Unbekannten, dem Uneindeutigen, welche sich zum fokalen Punkt des Romans entwickelt. Wie ein Echo scheinen sich hierbei auch Debatten und Ängste der heutigen Zeit widerzuspiegeln. Ob man nun an erstarkende rechtskonservative politische Bewegungen in Europa oder den USA denkt, den antifeministischen Backlash, zunehmende Transfeindlichkeit, das immer offenere Zurschaustellen diskriminierender Inhalte in politischen Debatten oder eine Einschränkung der Empathie, welche nur für die eigene «Ingroup» gilt, allein dem zu Teil wird, was einem seit jeher bekannt ist. Dabei ist Fluidität, das Verschwimmen von Grenzen, oder gar deren Auflösung unweigerlich Teil der Natur, Teil unseres Daseins. Das Uneindeutige ist nichts Fremdes, sondern schon immer Teil von allem gewesen.